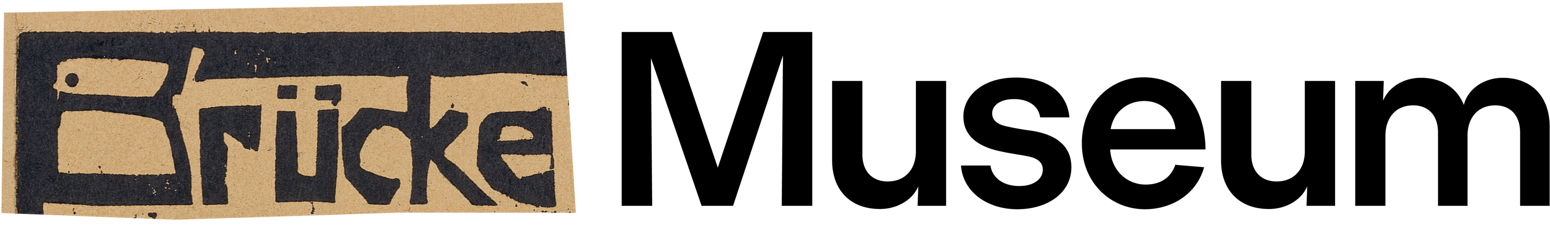White Privilege: Für Menschen mit weißen Privilegien funktioniert weiß-sein wie ein unsichtbarer Rucksack mit vielen Vorteilen
“The unquestioned and unearned set of advantages, entitlements, benefits and choices bestowed upon people solely because they are white” – Peggy McIntosh
Das Problem an Privilegien ist, dass sie für Menschen, die sie besitzen meist unsichtbar sind. Das liegt unter anderem daran, dass viele beim Wort „Privilegien“ an goldene Löffel und Privatflugzeuge denken. Darum dreht es sich aber nicht. Privileg bedeutet, dass ich der „richtigen“ (sprich: dominanten) Gruppe angehöre und deshalb in vielen Situationen – ohne eigenen Verdienst – Vorteile habe, die andere nicht haben.
„Whiteness“ oder weiß-sein ist so ein Privileg, das für Weiße* unsichtbar ist. Peggy McIntosh beschreibt weiß-sein deshalb als „invisible knapsack“ , als einen unsichtbaren Rucksack mit vielen Vorteilen, die man als Weiße*r zwar nicht wahrnimmt, aber jeden Tag aufs Neue benutzt.
Zum Beispiel, das Privileg nie über die eigene Hautfarbe nachdenken zu müssen: wenn man einen Job oder eine Wohnung nicht bekommt, muss man nicht überlegen, ob das vielleicht an der Hautfarbe lag. Oder wenn man von der Polizei kontrolliert wurde. Und wenn man einen Wochenendausflug/Urlaub plant, muss man sich keine Gedanken darüber machen, an welchem Ort man als Weiße*r sicher ist. Und selbst bei ganz alltäglichen Dingen, wie dem Kauf eines Pflasters, kann man ziemlich sicher sein, dass das Produkt der Hautfarbe einer Person mit weißen Privilegien ähnelt. Denn in diesem System ist weiß-sein die Norm und der unsichtbare Maßstab, gegenüber dem das Nicht-weiße als Abweichung dargestellt ist.
Die unsichtbare Norm
Für Personen, die rassistisch diskriminiert sind, ist weiß-sein keine unsichtbare Norm sondern kontinuierlich Thema. Doch für Personen mit weißen Privilegien ist diese normstiftende Position nur schwer zu fassen. Dabei ist sie überall präsent und abgebildet in diesem Land: in den Medien, der Werbung, den Lehrstühlen, im Bundestag und in den Chefetagen. All diese Positionen sind fast ausschließlich von Personen mit weißen Privilegien besetzt, die ihre eigene Homogenität aber nicht bemerken.
Deshalb ist es Ziel der „Critical Whiteness Studies“ (zu Deutsch: kritische Weißseinsforschung) weiße Privilegien zu demaskieren und die Privilegierten darauf aufmerksam zu machen, dass auch ihre Hautfarbe nicht unsichtbar ist, sondern ebenso Auswirkungen auf die Lebenssituation hat wie bei Schwarzen Menschen oder People of Colour. Mit einem grundlegenden Unterschied: Die einen werden wegen ihres Aussehens oder ihrer vermeintlichen ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert, während die anderen Privilegien erfahren.
Kulturwissenschaftler Richard Dyer erklärt den Zweck dieser Sichtbarmachung in klaren Worten:
‘As long as race is something only applied to non-white people, as long as white people are not racially seen and named, they/we function as a human norm. Other people are raced, we are just people.“
Weiß-sein als soziales Konstrukt
Entgegen der geläufigen Meinung ist weiß-sein nicht in der Biologie oder Genetik verankert, sondern ein soziales Konstrukt, das erst im 17. Jahrhundert mit dem Eingang des biologischen Rassenbegriffs in die europäische Wissenschaft begann. Erst hier hat man angefangen, Menschengruppen aufgrund von phänotypischen – also äußerlichen – Merkmalen zu hierarchisieren. Die Erfindung der „Rasse“ galt, vor allem in der Hochzeit des Kolonialismus im 19. Jahrhundert, als Rechtfertigung für Unterwerfung, Ausbeutung, und Versklavung.
Im 20. Jahrhundert trieben die Nationalsozialist*innen mit ihrer Rassenideologie diese von der europäischen Aufklärung formulierte Denk- und Handelsweise auf die Spitze.
Die Entwicklungen in der Genetik, der Anthropologie und der Biologie im 20. und 21. Jahrhundert zeigt, dass die wissenschaftliche Klassifizierung von Menschen anhand rassischer Merkmale unhaltbar ist. So wurde zum Beispiel belegt, dass Individuen innerhalb einer als „Rasse“ definierten Gruppe oft untereinander größere genetische Unterschiede aufweisen als zwei Individuen aus unterschiedlichen „Rassen“.
Race – a Floating Signifer?
Aus rein wissenschaftlicher Sicht gibt es also keine „Menschenrassen“. Warum gibt es dann immer noch Rassismus? Eine der klarsten Antworten darauf, finden wir in Stuart Halls vielzitierter Vorlesung Race, the Floating Signifier:
„Differences exist in the world. But what matters are the systems of thought and language we use to make sense of those differences.“
Hall erklärt also, dass es Unterschiede in der Welt gibt. Aber welche Rolle diese Unterschiede spielen ist nicht durch ihre Biologie oder DNA festgelegt, sondern dadurch, wie wir sie lesen und bewerten. In anderen Worten: welche Unterscheidungen für uns wie und auf welche Weise relevant werden, ist nicht eine Frage der Biologie/Genetik, sondern unserer Kultur, unsere Gesellschaft und unserer Geschichte.
Unsere weiße Geschichte und Kultur konditionierten uns, manche Sachen sichtbar bzw. unsichtbar zu machen. So sehen insbesondere liberale Weiße oft nicht, wie sie durch ihre Denk- und Handlungsmuster white privilege verstärken. Tupoka Ogette schreibt dazu:
„Wir sind in einer Welt aufgewachsen, der seit über dreihundert Jahren Rassismus tief in den Kochen steckt. So tief, dass es keinen Raum gibt, in dem er nicht zu finden ist. Und einfach dadurch, dass Du in dieser Welt lebst, wurdest Du Teil des Systems. In der Art, wie Du über Dich und über andere sprechen und denken gelernt hast: durch Kinderbücher, die Du vorgelesen bekommen hast, die digitalen Medien, die Du von klein auf konsumiert hast, Deine Schulbücher … alles. Kurz gesagt: Du bist rassistisch sozialisiert worden. So, wie viele Generationen vor Dir, seit über dreihundert Jahren.“
White Fragility: Oder warum Weiße ungern über White Privilege reden
Soziologin Robin DiAngelo beschreibt in einem Artikel anschaulich, wie schwer es ist, mit weiß privilegierten Menschen in Workshops oder Seminaren über white privilege zu reden. Denn:
1. Weiße Menschen sind es nicht gewohnt aufgrund ihrer Hautfarbe kategorisiert zu werden, sondern als Individuum ohne Merkmal wahrgenommen zu werden. Diskussionen um white privilege machen sie darauf aufmerksam, dass sie nicht einfach „Menschen“ sind, sondern weiße Menschen. Das heißt, sie sind nicht ausgenommen von der gesellschaftlichen Bestimmung durch ethnische Merkmale. Und diese Bestimmung verschafft ihnen eine Sonderrolle.
2. Das Wort „Privileg“ fühlt sich für viele Weiße, die zum Beispiel ökonomisch benachteiligt sind, falsch an. Es ist also auch bei Debatten um white privilege wichtig, intersektional zu denken: White privilege bedeutet nicht, dass man nicht in anderen sozialen Kategorien strukturell benachteiligt sein kann oder, dass das Leben frei von Schwierigkeiten wäre. Es bedeutet lediglich, dass die eigene Hautfarbe nicht der Grund ist, warum man Schwierigkeiten hat.
DiAngelo bezeichnet die emotionsgeladenden Abwehrreaktionen, die Menschen mit weißen Privilegien in Debatten über Rassismus oder die eigenen Privilegien zeigen, als Ausdruck von „white fragility“ (zu Deutsch: weiße Zerbrechlichkeit). Demnach sind Weiße „zerbrechlich“, da sie in den USA (bzw. Deutschland) nie den Stress erfahren, den Rassismus auslösen kann.
Wenn sie nun in einer Konversation oder einem Seminar dazu „gezwungen“ werden sich ihrer eigenen rassistischen Denk- und Handlungsweisen bewusst zu werden, zeigen sie white fragility: Diese Reaktionen äußert sich meist darin, dass die Personen abblocken, sehr emotional werden (oft wütend oder defensiv), Rassimuserfahrungen von Schwarzen oder People of Colour relativieren oder versuchen die Situation so schnell wie möglich zu verlassen, die sie als unangenehm oder unerträglich wahrnehmen.
Diese Reaktionen führen dazu, dass von Rassismus Betroffene aufhören, ihre Erfahrungen mitzuteilen, weil sie befürchteten, dafür angegriffen zu werden.
Außerdem führt die emotionale Reaktion dazu, dass sich der Fokus verschiebt: Es geht nicht mehr, um die Rassismuserfahrungen von Betroffenen, sondern um die Gefühle nicht Betroffener. Wie Richard Dyer im Vorwort zu seinem Buch White schreibt:
„Weiß-sein zu thematisieren hat das inhärente Problem, dass es weißen Menschen die Absolution gibt das zu tun, was sie am liebsten machen: über sich selbst zu reden.“
Damit Debatten um white privilege Veränderungen bringen können, ist es also wichtig Rassismus nicht zu individualisieren, sondern als gesellschaftliche Struktur zu verstehen, die sich unterschiedlich auf Menschen auswirkt.
*Der Ausdruck „Weiße“ ist problematisch, da er weiß-sein essenzialisiert. Ich benutze ihn in diesem Blogeintrag an manchen Stellen trotzdem, um über Personen mit weißen Privilegien und den konkreten Effekten, die daraus erwachsen, zu sprechen.
**Weiß ist in diesem Blogeintrag kursiv geschrieben, um die konstruierte Natur dieses Begriffes zu verdeutlichen. Es ist klein geschrieben, da es sich, im Gegensatz zu Benennungen wie Schwarz und People of Colour, um keine politische empowernde Selbstbezeichnung, sondern um die konkrete Benennung einer privilegierten Positionierung handelt. Ich folge hier Lann Hornscheidt.
Anne Graefer, “Die (Un)Sichtbare Norm: Was Ist Eigentlich White Privilege?” GenderIQ, 22. Juli 2020. https://www.genderiq.de/blog/was-ist-eigentlich-white-privilege.
Anne Graefer, Gründerin von GenderIQ I Diversity & Inclusion