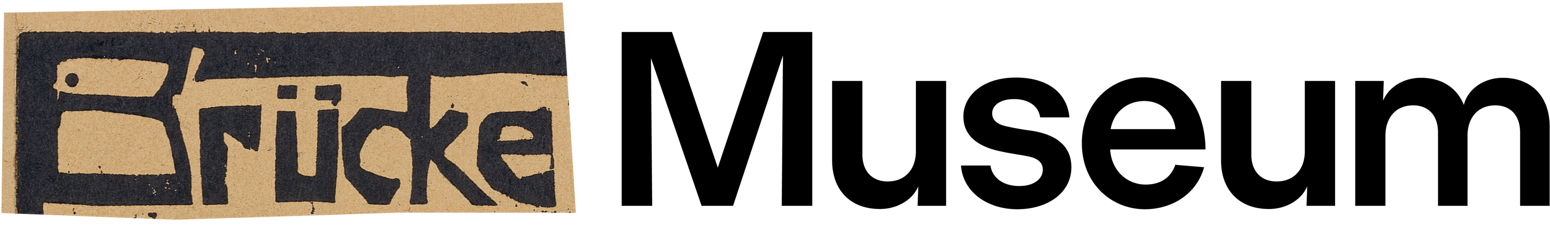Wer ist sichtbar? Wer bleibt unsichtbar? Diese Fragen entscheiden nicht nur darüber, wem gesellschaftspolitische Relevanz zugesprochen wird, sondern auch darüber, wer Macht – und damit auch Geld, Handlungsoptionen, Ruhm und vieles mehr – erhält. In Sammlungen moderner Kunst, wie der des Brücke-Museums, wird vor allem eine Bevölkerungsgruppe und damit deren Blick auf die Welt sichtbar: weiße, westliche – und in diesem Fall auch – tote Männer. Personen, die nicht weiß oder nicht männlich sind, werden durch sie abgebildet: als Objekte in ihren Werken. Die eigenen Perspektiven von Menschen, die von dieser Kategorie abweichen (oder als abweichend gelesen werden), wie beispielsweise Frauen, Schwarze Personen oder Personen mit Behinderungen, sind bis heute in Museen und öffentlichen Sammlungen selten zu finden. Und wenn doch, werden sie häufig auch hier als „das Andere“ exotisiert, um einerseits das Besondere ihrer Position zu fetischisieren und andererseits unter Beweis zu stellen, wie weltoffen und empfänglich die meist weißen Institutionen für diverse Perspektiven sind.
Wie könnten andere, gerechtere Formen von Sichtbarkeit erreicht werden?
Die Kulturwissenschaftlerin und Aktivistin Araba Evelyn Johnston-Arthur hält fest, dass Darstellung und Beherrschung eng miteinander verzahnt sind. Für sie ist das Konzept der Sichtbarkeit deshalb „mit dem Kampf um selbstbestimmte, emanzipatorische, dekolonisierte Bilder verbunden […]. D.h. mit unseren vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Schwarzen Befreiungsprozessen und der Erkämpfung unserer Sichtbarkeiten als politische Subjekte.“ Und weiter hinterfragt die Kunsthistorikerin Johanna Schaffer die Ambivalenzen der Sichtbarkeit und die vor allem in aktivistischen Kreisen weit verbreitete Annahme, mehr Sichtbarkeit bedeute mehr politische Präsenz oder Durchsetzungsvermögen. Denn jede Sichtbarkeit ist nur innerhalb vorgeformter, bereits bestehender Strukturen lesbar und daher in ihrer Wirkkraft von Beginn an eingeschränkt. Auch der Schriftsteller Édouard Glissant, bekannt geworden als einer der Vordenker der Créolité, einer Theorie zu kultureller Hybridität, plädiert für ein Recht auf Unlesbarkeit, Dunkelheit, Unsichtbarkeit: „Ich muss den Anderen nicht ‚verstehen‘, ihn also nicht auf das Modell meiner eigenen Transparenz reduzieren, um mit diesem Anderen leben oder mit ihm etwas aufbauen zu können.“ Dieses Recht, unverständlich zu bleiben, sich der vollkommenen Transparenz zu entziehen, wurde oftmals als postkolonialer Widerstand gegen die bis heute vorherrschende westliche Dominanz interpretiert, er bezeichnet das als Opacité (opak = lichtundurchlässig). So kann auch die Weigerung junger PoC- bzw. nicht westlicher Künstler*innen, am westlichen Kunstmarkt nur unter ihnen von außen auferlegten Bedingungen zu partizipieren, als eine solche Strategie verstanden werden. Sie werden hier als „Andere“ gelesen und als solche markiert; es ist das Gegenteil von Selbstbestimmung und die Verweigerung dieser Zuschreibung wird dadurch zum widerständigen Akt. Denn es stellt sich immer auch die Frage: Über wessen Sichtbarkeit reden wir hier, und für wen und zu welchen Zwecken?
Literatur:
Araba Evelyn Johnston-Arthur, Jo Schmeiser: „… das ideologische Wesen der Bilder dekonstruieren“, in: Graswurzelrevolution 303, November 2005.
Édouard Glissant: „Introduction à une poétique du divers”, Gallimard, Paris 1996. S. 53–54.
Sonja Eismann, Mitherausgeberin des Missy Magazine, schreibt und forscht zu Feminismus und (Pop-)Kultur