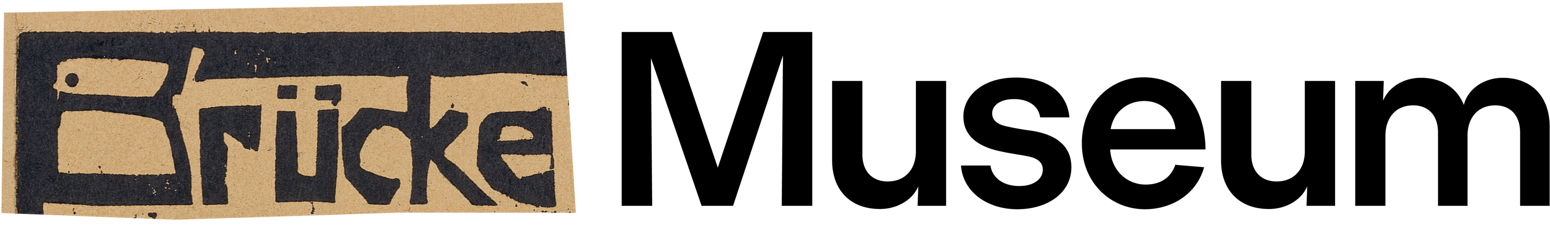Viele Menschen denken bei diesem Begriff in erster Linie an ein mehrstimmiges Musikstück, bei dem die Gesangstimmen nacheinander einsetzen und mit derselben, aber versetzt gesungenen Melodie ein harmonisches Ganzes bilden. Die erste Stimme dient dabei in gewisser Weise als Richtschnur.
Manchmal hilft es, sich einen Begriff über die Geschichte des Wortes zu erklären: Kanon leitet sich aus dem lateinischen canon ab und bedeutet „Norm“ oder „Regel“. Im Griechischen bedeutete er Mustergültiges oder Maßgebendes – und war dort wiederum ein dem Hebräischen entlehntes Wort für ein Schilfrohr, das als Längenmaß diente.
Wenn heute in Kunst, Literatur, Musik oder Film von Kanon die Rede ist, geht es um die Zuschreibung von Qualität, von Wert und Wichtigkeit. Die Frage, die diesen imaginären und mitunter auch tatsächlich aufgeschriebenen Listen zugrunde liegt, lautet dabei in etwa: Was verkörpert künstlerische Brillanz und wird auch noch in zehn, hundert oder tausenden von Jahren Relevanz haben?
Auch Erziehung, Bildung, kulturelle Institutionen und Medien entscheiden darüber, wer in den Kanon aufgenommen wird und wer draußen bleiben muss. Welche Bücher und Gemälde in der Schule vorkommen, vermitteln schon Kindern, was als „wichtig“ und „gut“ wahrgenommen wird – und wer unbekannt bleibt. Auch Museen bestimmen mit ihrer Sammlungs- und Ausstellungspolitik, was wertgeschätzt und überhaupt sichtbar wird.
Da die Fragen nach kreativer Qualität seit jeher strittig sind und immer umkämpfter werden, je stärker seit der Moderne handwerkliche Qualitäten wie „gut malen“ oder „gut erzählen“ in den Hintergrund treten, gibt es seit einigen Jahrzehnten heftigste Auseinandersetzungen um den Kanonbegriff. Warum sind so wenige Frauen vertreten? Warum fast nur weiße Menschen? Und wieso wird hauptsächlich westliche Kunst darin erfasst? Sind wirklich nur, überspitzt formuliert, Werke von toten weißen Männern wertvoll?
Dies war auch einer der vielen Kritikpunkte an einem Buch des Literaturwissenschaftlers Harold Bloom, in dem er 1994 den Western Canon verteidigte. Während dessen Veröffentlichung tobten an US-amerikanischen Universitäten bereits die sogenannten „Canon Wars“, also Kanonkriege. Denn gerade PoC-Studierende wollten es nicht mehr hinnehmen, ihre eigenen Identitäten und Erfahrungen so gut wie gar nicht in den kanonisierten Lehrinhalten widergespiegelt zu sehen.
Heute lässt sich zwar von einer Pluralität von Kanons sprechen, andererseits werden die Debatten weiterhin geführt. Denn auch wenn verschiedenste, vormals oder bis heute marginalisierte Gesellschaftsgruppen es geschafft haben, dass auch ihre künstlerischen Perspektiven als wertvoll anerkannt werden, sind westlich-patriarchal-koloniale Dominanzverhältnisse noch lange kein Ding der Vergangenheit. So ändern z.B. sogenannte „Frauenausstellungen“, von denen es immer mehr gibt, oder eine erhöhte Aufmerksamkeit für Künstler*innen aus dem Globalen Süden nichts daran, dass in Lehrbüchern und Sammlungen weitgehend immer noch die althergebrachte Geschichte weiß-männlicher Vorherrschaft erzählt wird.
Eine finale Antwort auf die Frage, was ein Werk „gut“ macht, wird es jedoch niemals geben. Denn Werturteile in der Kunst sind immer auch Markt- und Geschmacksurteile und von der Geschichte, der Prägung und Position der urteilenden Person gefärbt. Aber es gibt immerhin die Möglichkeit, unsere Perspektiven darauf gemeinsam zu hinterfragen, zu reflektieren, neu zu denken und immer wieder zu verhandeln. Am besten gemeinsam und möglichst vielstimmig.
Sonja Eismann, Mitherausgeberin des Missy Magazine, schreibt und forscht zu Feminismus und (Pop-)Kultur