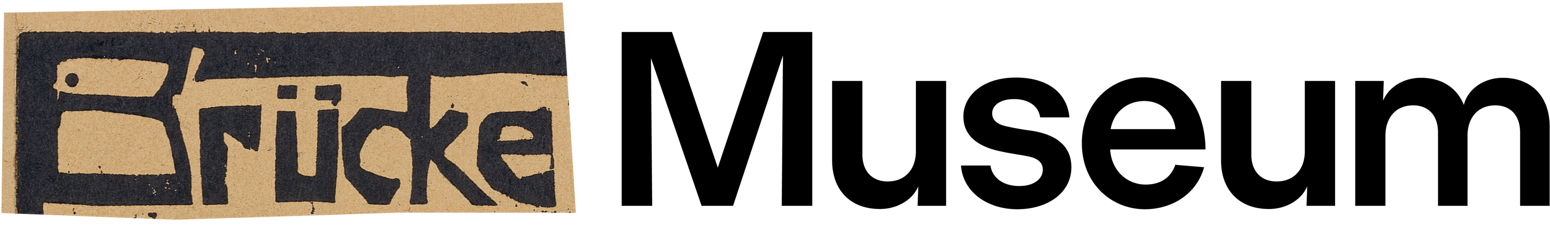Sich betrachten, in Szene setzen, posieren. Eine Pose einnehmen ist weitgehend negativ konnotiert. Aber warum eigentlich? Ist Posen tatsächlich so narzisstisch wie uns die Gesellschaft, das Patriarchat, versucht einzureden?
Liebeslieder, Filme und Bücher handeln davon, wie eine Frau im Patriarchat zu sein hat: bescheiden. „Das Schönste an dir ist, dass du nicht weißt, dass du schön bist“ und „Du weißt nicht, wie schön du bist, aber lass es mich dir zeigen“ sind zwei der beliebtesten Zitate, die Männer in Medien über Frauen sagen. Diese Aussagen beziehen sich auf das äußere Erscheinungsbild von Frauen, denn dieses gilt im Patriarchat als ihr wichtigstes Gut. Aber nur, solange Männer die Entscheidungsgewalt darüber behalten. Der gelesene Frauenkörper ist gerne gesehen, solange er vermarktbar bleibt, in sexistische Idealvorstellungen fällt und aus ihm Kapital geschlagen werden kann.
Selbstbewusstes Posen wurde bereits durch die Bewegung der Ballroom Culture der US-amerikanischen queeren Szene in den 1970er und 1980er Jahren geprägt. Spezifisch Schwarze queere Personen und queere People of Color dominierten die Bälle. Da sie aus der weißen queeren Szene ausgeschlossen wurden, schufen sie sich eigene Orte. Auf den Bällen wurde vor allem der Tanzstil Voguing praktiziert, welcher sich an glamourösen Posen berühmter Models aus Modemagazinen orientierte. Queere Schwarze Menschen und queere People of Color fanden in Modezeitungen wie der Vogue keine Repräsentation. In der Ballroom-Szene erweiterten sie die üblichen Model-Posen zu extravaganten Performances. So besaßen sie Räume, wo sie ihre Identitäten und Körper zelebrieren konnten. Im Mainstream wurde die Voguing-Kultur immer mal wieder zum Trend, so beispielsweise durch Madonnas Hit Vogue, der in den 1980er Jahren Elemente der Ballroom Culture aneignete. Vor wenigen Jahren wurde die Serie Pose auf den Sendern FX und Netflix veröffentlicht und lieferte einen erneuten Hype der Voguing-Kultur. Mehrheitsgesellschaftlich führte dies aber nur bedingt zu Veränderungen. So wurde beispielsweise jahrelang keine der Schwarzen trans Hauptdarstellerinnen für ihre Erfolgsleistungen für einen Emmy nominiert, wohingegen der einzige cis Mann der Serie wiederholt Nominierungen erlangte. Fern von Hollywood sind Schwarze queere Menschen, allen voran Schwarze trans Frauen, noch ganz anderen, unvergleichlich extremeren Diskriminierungen ausgesetzt. Doch auch ihre bahnbrechenden Errungenschaften als Vorreiter*innen fast aller Bewegungen werden viel zu selten anerkannt, geschätzt und entlohnt.
Heutzutage ist der Begriff des Posens den meisten Menschen vor allem aus Social-Media-Kontexten bekannt. Auch hier verfestigen sich bestimmte Schönheitsideale. So gibt es eine Vielzahl an Apps, die das Äußere durch Retusche-Tools verändern. Darüber hinaus wird täglich neuer Video- und Fotocontent gepostet, der vorgibt, wie man am besten die vermeintlich richtigen und schmeichelhaften Bildposen umsetzen könnte. Doch neben weiterhin stattfindenden Reproduktionen von problematischen Idealen hat sich mit der Selbstdarstellungswelle im Internet auch etwas Positives entwickelt: Die gelernte Bescheidenheit der Menschen, die keine weißen cis Männer sind, rückt immer mehr in den Hintergrund. Sich zur Schau stellen wird nicht mehr allein negativ bewertet. Vielmehr geht es um Selbstermächtigung und darum, die eigenen Rechte am Ich und der Selbst-Präsentation zu besitzen. Denn Frauen und queeren Menschen wurde bisher das Gegenteil vermittelt. Das führt dazu, dass sich viele von ihnen ständig selbst hinterfragen und stetig als unzureichend verstehen.
Dem gegenübertreten kann die selbst kuratierte Darstellung im digitalen Raum, bei der individuelle Körper posierend in Szene gesetzt werden können. Natürlich ist dabei zu beachten, dass diese Kanäle nicht außerhalb des Kapitalismus, des weißen Vorherrschaftssystems und des Patriarchats liegen. Auch sie sind Normen und Routinen eines kapitalistischen Marktes unterworfen und dementsprechend gefiltert, aus- oder einsortiert. Welche Personen werden auch online durch fortbestehende Normen und diskriminierende Filter bzw. Algorithmen verdrängt? Diese Algorithmen und Filter der Künstlichen Intelligenz wurden von Menschen programmiert. Ausgrenzende Praktiken sind auch hier, wie gesamtgesellschaftlich, nicht auszuschließen. Studien aus intersektional feministischer Sicht belegen, dass Diskriminierungen wie Sexismus und Rassismus in artifiziellen Intelligenz-Systemen sogar verstärkt auftreten. Durch technologische Algorithmen werden Entscheidungen somit keinesfalls objektiver oder gerechter getroffen.
Die heteronormative, weiße, patriarchale Dominanzgesellschaft suggeriert jeder Person, die kein cis Mann ist, immer und überall, sie sei nicht wertvoll genug, um Raum einzunehmen. Jene marginalisierten Personen, die sich dem entgegenstellen und ein selbstbewusstes öffentliches Bild von sich preisgeben, werden oftmals als übertrieben, eingebildet, arrogant, aufmerksamkeitsheischend verunglimpft. Als marginalisierte Person für sich und andere Raum zu kreieren und einzunehmen, entgegen all dieser Gewalt, ist nicht nur anti-patriarchal, sondern politisch.
Menschen müssen ohnehin jeden Tag in der neoliberalen Gesellschaft posen. Auch weiße Menschen müssen sich bei Vorstellungsgesprächen, Abendessen oder Veranstaltungen präsentieren. Insbesondere Schwarze Menschen hingegen spüren diesen Perfomance-Druck überall. Selbst bei der simplen U-Bahnfahrt sind sie tagtäglich gewaltvollen Blicken, Kommentaren oder Racial Profiling ausgesetzt. Sie haben daher ein allgegenwärtiges Bewusstsein dafür, wie sie auf andere wirken. Viele betrachten ihr Selbst wie durch einen omnipräsenten Spiegel. Code-Switching gehört zu ihrem Alltag dazu. Code-Switching beschreibt den Wechsel eines Habitus oder einer Sprache, je nachdem, mit wem kommuniziert wird. Dabei kann es sich beispielsweise um Szenesprache, Dialekt, Umgangssprache oder Wissenschaftssprache handeln. Oft wird Code-Switching insbesondere von marginalisierten Gruppen benutzt, um sich zu assimilieren, dadurch Schutz und soziökonomische Faktoren zu sichern. Schwarze Menschen werden beispielsweise speziell im Berufsleben wiederholt mit rassistischen Stereotypisierungen konfrontiert. So werden ihnen oft Attribute wie wütend, unhöflich und aggressiv zugeschrieben. Das gezielte Erlernen einer öffentlichen Persönlichkeitsetikette, die von weißen Menschen nicht als bedrohlich, zu laut, fordernd, forsch oder zu leise, unsicher und nicht schlau genug wahrgenommen wird, ist eine derartige Performance, die das Wort Arbeit nicht im Ansatz beschreiben kann. Sie bedeutet, sich öffentlich immer ein Stück selbst aufzugeben, um nicht erneut Gewalt erfahren zu müssen.
Das alleinige Existieren in diesem System geht für marginalisierte Menschen somit immer mit Posen und Performen einher und ist eine notwendige Überlebensstrategie.
Die Selbstdarstellung marginalisierter Menschen kann schlussfolgernd nie einfach nur oberflächlich und kokett sein. Sich Orte zu schaffen, um das eigene, sonst unterdrückte Selbst zu zelebrieren, ist wichtig und feministisch. Davon auszugehen, dass in diesem Gesellschaftssystem für alle Menschen ein Raum existiert, bei dem das möglich ist, ist dennoch eine Illusion.
Josephine Papke (sie/ihr,they/them, keine Pronomen) studierte Theater-und Filmwissenschaft, arbeitet vielfältig im Kulturbereich und verhandelt dort am liebsten die Intersektionen von Queerness, BIPoC Identitäten und Popkultur