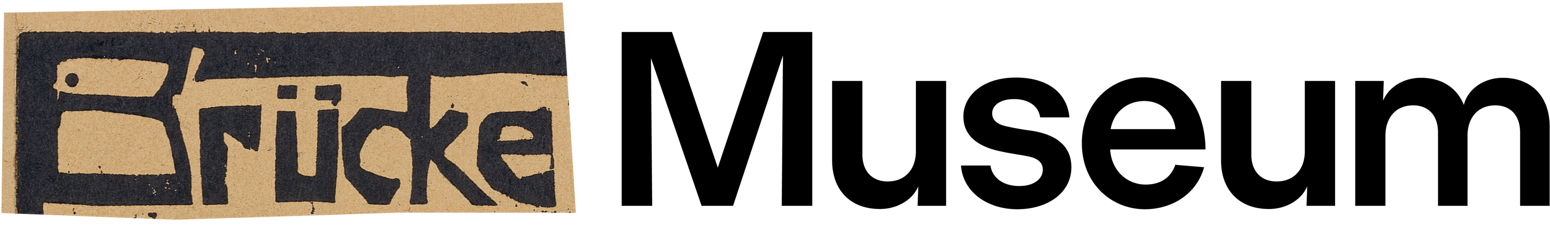(Lea Susemichel)
Best Friends Forever
Frauen sind doppelzüngige Lästerbacken, wahre Freundschaft ist männlich, lautet ein bis heute wirkmächtiges uraltes Vorurteil. Stimmt natürlich nicht, sagt Lea Susemichel. Für eine Politik der Freundinnenschaft.
„Friends“ heißt die Lego-Serie in Pink und Lila, die es eigens für Mädchen gibt. Für gewöhnlich sind es auch Mädchen und nicht Jungs, die zueinander zärtlich „BFF“ (Best Friends Forever) sagen. Danach knüpfen sie Freundschaftsbänder nach Anleitung der Bravo, in der es für sie obendrein Ratschläge gibt, wie innige Mädchenfreundschaften die Konkurrenz durch den ersten Boyfriend überleben. Eine seit Jahrzehnten bestehende deutsche Frauenzeitschrift nennt sich Freundin und verkauft damit ebenfalls erfolgreich das Gefühl von Vertrauen, Vertrautheit und Verbundenheit. Romane wie Ratgeberliteratur reproduzieren begleitend das zugrundeliegende Klischee, wonach Mädchen und Frauen fürs Gefühl zuständig seien und deshalb die intensiveren Freundschaftsbeziehungen leben würden, während Männer sich zwischenmenschlich weiterhin einfach nicht richtig öffnen könnten. Pop- und Alltagskultur liefern also scheinbar jede Menge Vorlagen, um weibliche Freundinnenschaft zu feiern. Doch bei näherer Betrachtung stellt sich überraschenderweise heraus: Freundschaft ist dennoch ein kulturell zutiefst männliches Konzept.
Barbie statt Buddy. Was die Popkultur neben einem Freundinnenmodell wie jenem von Sex and the City nämlich nicht nur in Blockbustern und Fernsehserien tatsächlich anbietet, sind vor allem Stereotype rivalisierender Nachbarinnen und zänkischer Vorstadtweiber, die in gehässiger Weise übereinander herziehen und sich miteinander ausschließlich über Männer unterhalten oder gar um sie streiten. Der sogenannte Bechdel-Test zeigt: Filme, in denen es erstens mindestens zwei Frauenrollen mit Namen gibt, diese Figuren zweitens miteinander sprechen und drittens sogar über etwas anderes als einen Mann, sind weiterhin die Ausnahme. Die klassischen Buddy-Movies hingegen, in denen zwei Menschen miteinander durch dick und dünn gehen, sind meist rein männlich besetzt. (Rare Gegenbeispiele sind etwa das grandiose Roadmovie Thelma und Louise und die herzzerreißende 1980er-Schmonzette Freundinnen mit Bette Middler.) Bereits Kinder werden deshalb paradoxerweise parallel zum Glitzerherzchen-Freundinnenkult früh an die perfide Bedeutung des vielbeschworenen „Zickenkriegs“ herangeführt und ins Biestigsein eingeübt: Schon in der Barbie-Zeichentrickserie werden Mädchen und Frauen als intrigante Schlangen inszeniert.
Seite an Seite? Doch empirische Studien der „Social-Support“- und Freundschaftsforschung zeigen, dass Frauenfreundschaften verbreiteter, intensiver und beglückender sind als Männerfreundschaften, Frauen ihre Freundschaften wichtiger nehmen und diese auch mehr konkreten Beistand bedeuten als zwischen Männern.
Ein veritables Hindernis für innige Männerfreundschaft ist außerdem Homofeindlichkeit. Denn während auch Freundinnen durch die Stigmatisierung als Lesben abgewertet wurden (und werden), ist körperliche Nähe und der Austausch von Zärtlichkeiten zwischen Männern noch weit stärker tabuisiert. Wie bereits der Begriff „Busenfreundin“ verdeutlicht, wird Frauen körperliche, auch homoerotische Intimität eher zugestanden.
Bei solchen Vergleichen muss allerdings unbedingt klar sein, dass es sich bei diesen „weiblichen“ und „männlichen“ Modellen von Freundschaft um tradierte soziokulturelle Konstruktionen handelt, die keinesfalls in essentialistischer Weise notwendig an eine biologische Geschlechtsidentität gebunden sind. Weshalb es z.B. selbstredend auch jede Menge übel tratschender Männer und bis aufs Blut konkurrierender Frauen gibt. Frauen dürfen außerdem keineswegs als frei von Häme und ihre Freundinnenschaften auch nicht als Ort ständiger Harmonie und wechselseitiger Empathie glorifiziert werden – das sind sie, genau wie bei den Männern, nämlich definitiv nicht.
Solidarität & Sisterhood. Doch es gibt zum Glück den vielfachen Versuch, Freundinnenschaft als gelebte Solidarität und Sisterhood zu feiern – so existiert beispielsweise die Forderung, den Valentinstag in einen feministischen „Freundinnentag“ umzuwandeln. Frauenfreundschaft wird dabei als zentrale Ressource nicht alleine im gemeinsamen Kampf um Emanzipation, sondern vor allem fürs eigene Leben verstanden. So kann der Freundinnenkreis als Wahlfamilie dienen, die notfalls das Zwangssystem Verwandtschaft ersetzt und im Idealfall sogar soziale Sicherung bieten kann. Und abgesehen von der konkreten Unterstützung, die Freundinnen einander auf unterschiedlichen Ebenen zukommen lassen, sind sie in erster Linie eines: geliebte Gefährtinnen, die fürs eigene Glück unentbehrlich sind.
Insgesamt wird der Bedeutung von Freundinnenschaft jedoch viel zu wenig Aufmerksamkeit zuteil, daran hat selbst der jüngste „affective turn“ in den Geistes- und Sozialwissenschaften wenig geändert. Denn auch wenn der gesamte Bereich der „Gefühlsarbeit“ nun auch außerhalb der Gender Studies als wichtiger sozialer und politischer Faktor erkannt wurde, wird der Beitrag von Frauen dabei vornehmlich im Bereich reproduktive Arbeit bzw. Care-Arbeit verortet. Dabei wird analysiert, wie familiäre und freundschaftliche Fürsorgetätigkeiten und Liebesdienste von Frauen neoliberale Ausfälle kompensieren bzw. ihre affektive Arbeit sogar als Dienstleitung vermarktet wird.
Die poststrukturalistischen Figuren einer „Politik der Freundschaft“, wie sie im Anschluss an Jacques Derrida im Rahmen dieser „affective politics“ entworfen werden, scheinen hingegen insgeheim weiterhin ein eher männliches Konzept zu bleiben. Zumindest wurde die Rolle, die insbesondere Frauen – als die für soziale Beziehungen Hauptzuständigen – bei Widerstand und solidarisch-subversiver Vernetzung spielen, bislang wenig explizit zum Thema gemacht.
Doch nicht nur politisch, auch privat scheint die Pflege von Freundinnenschaften für alle ratsam zu sein. Selbst die große Liebesforscherin Eva Illouz wendet sich neuerdings lieber der Freundschaft zu und lobt sie als das viel wertvollere Gefühl. Eine Studie will herausgefunden haben, dass regelmäßiger Kontakt mit guten Freund*innen sogar gesünder ist, als sich das Rauchen abzugewöhnen. Das gilt geschlechtsunabhängig. Wie übrigens auch das ausschlaggebende Kriterium, weshalb jemand als bester Freund oder beste Freundin bezeichnet wird: das gute Gefühl nämlich, von diesem Menschen in der eigenen Identität erkannt und respektiert zu werden.